Offizielle Publikationen des Heimat- und Geschichtsverein Schaafheim e.V.
Die vorstehenden Publikationen sind im Schreibwarenladen Fleckenstein oder auf Anfrage direkt vom Verein zu beziehen, sofern noch nicht vergriffen. Preise bei Postversand zzgl. Versandkosten. Nutzen Sie dafür gerne unser Kontaktformular.
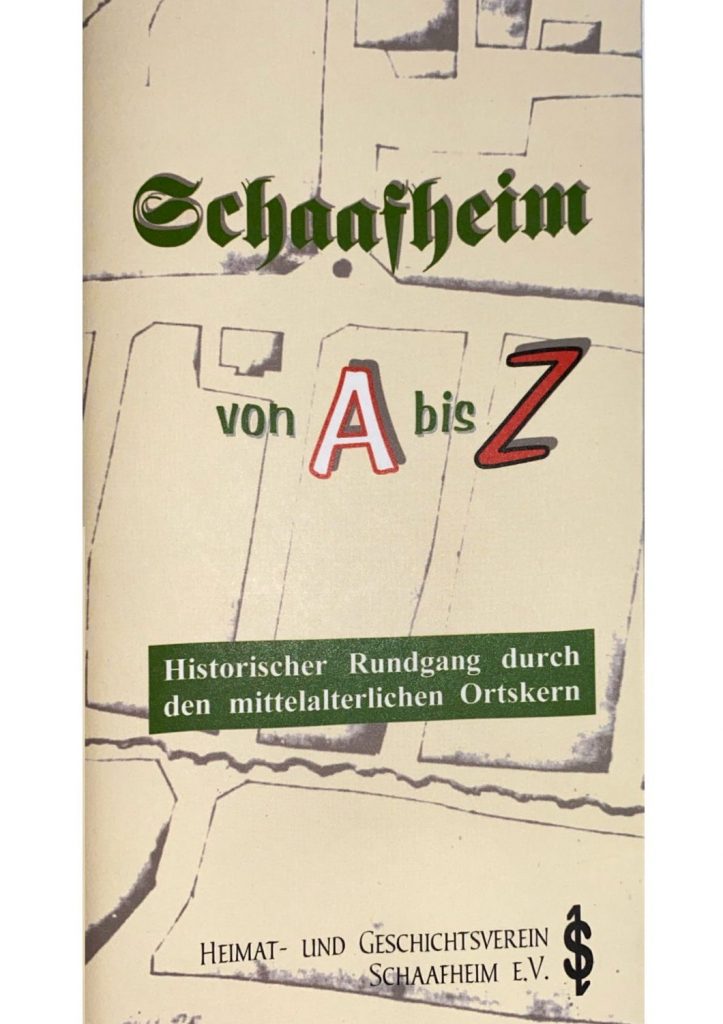
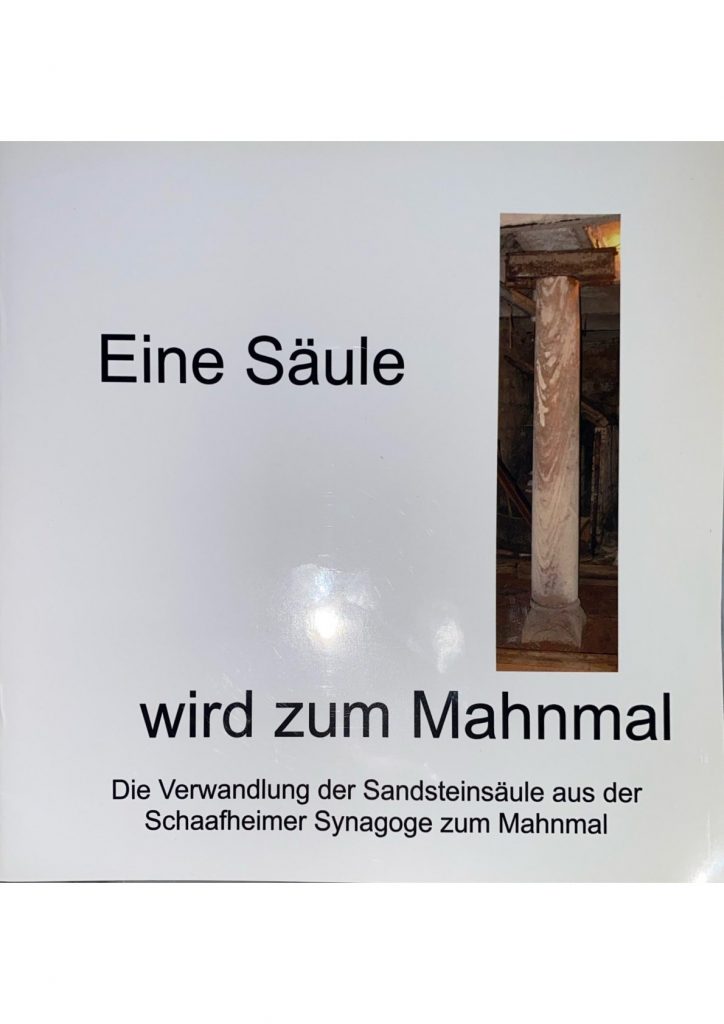
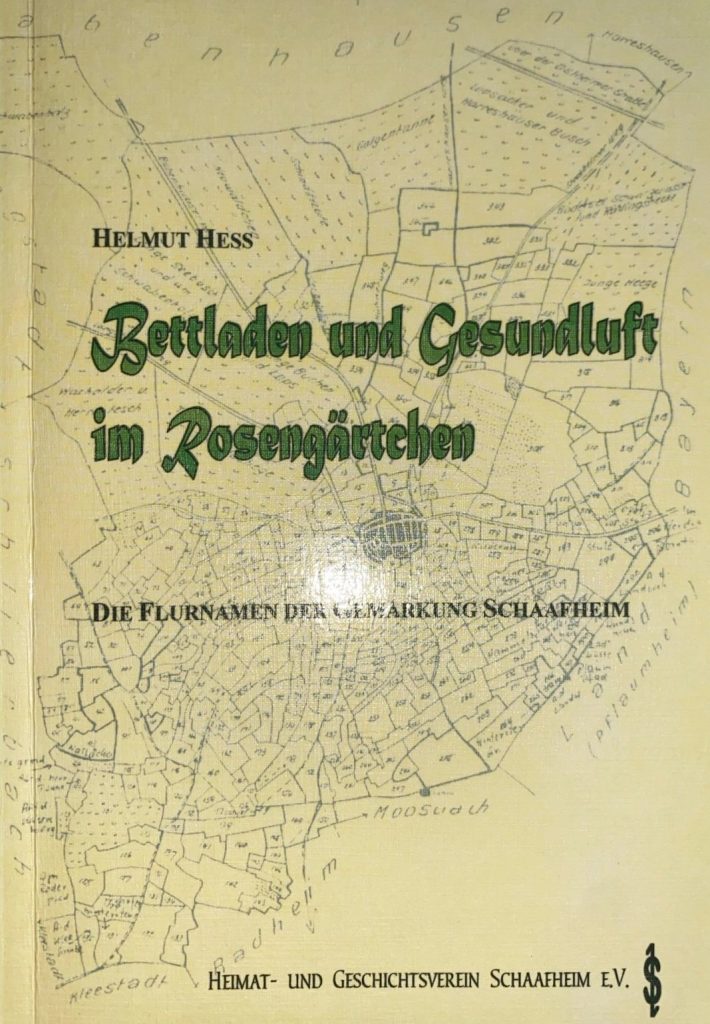
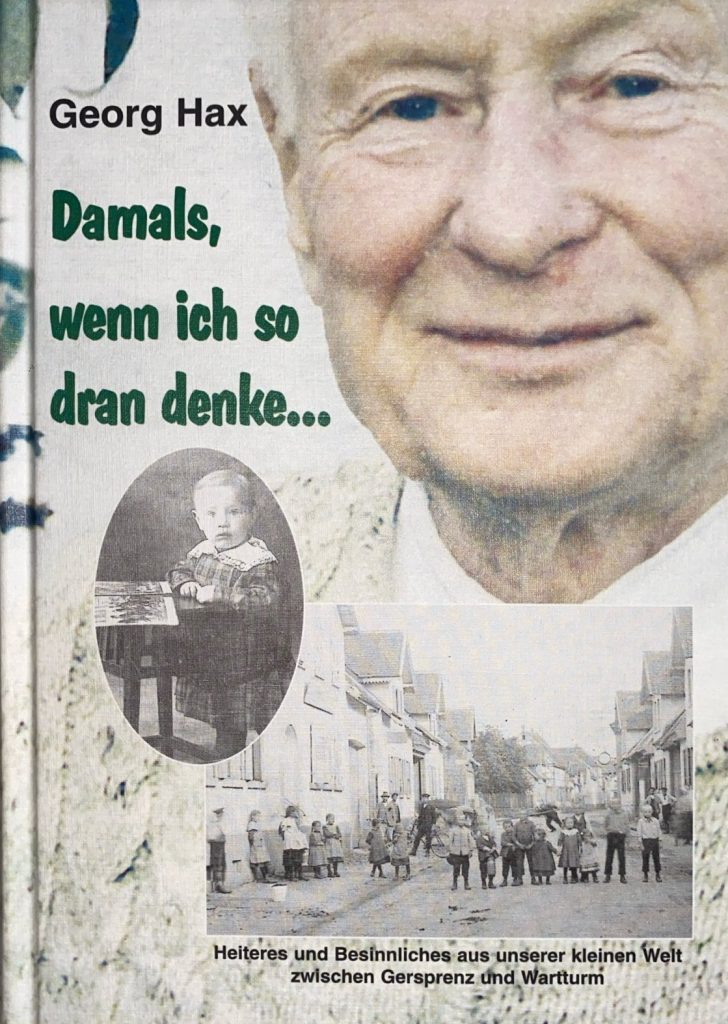
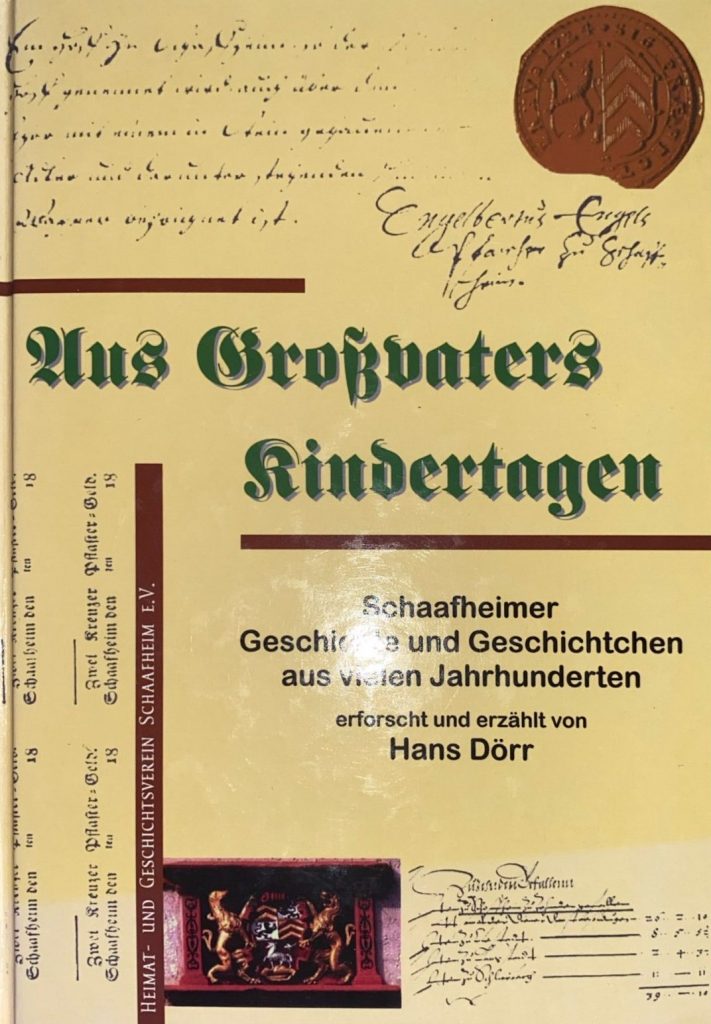
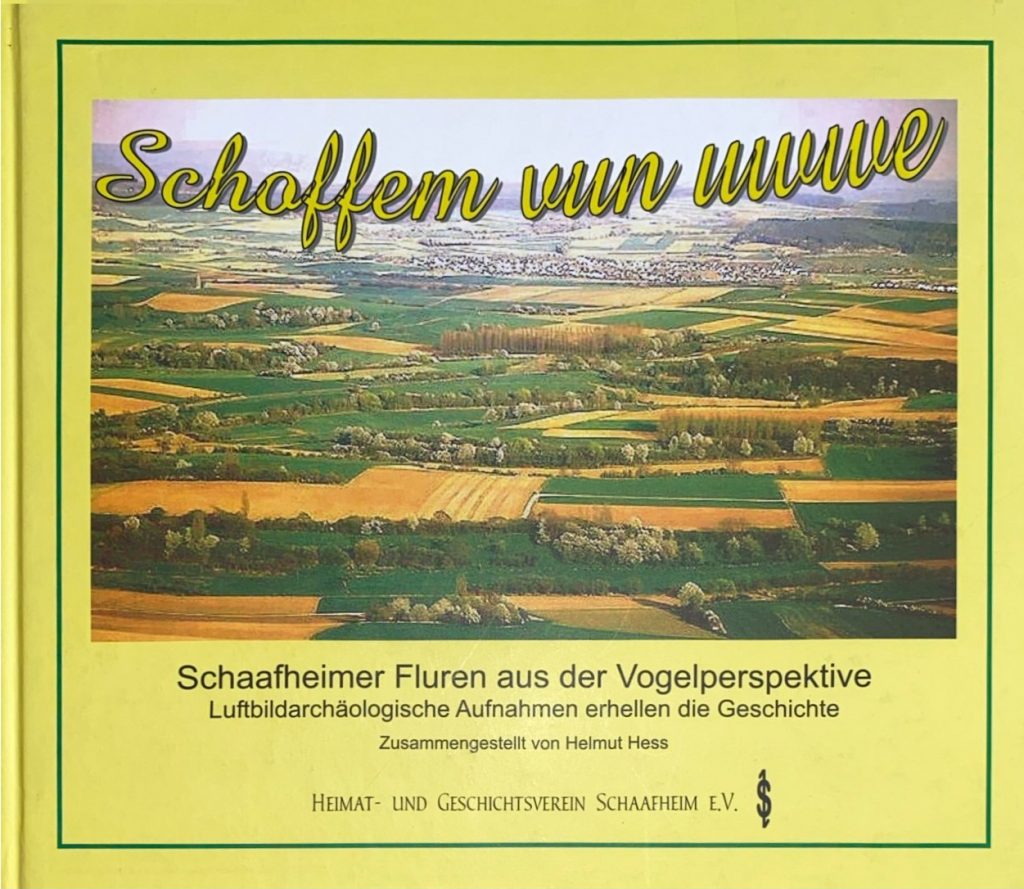
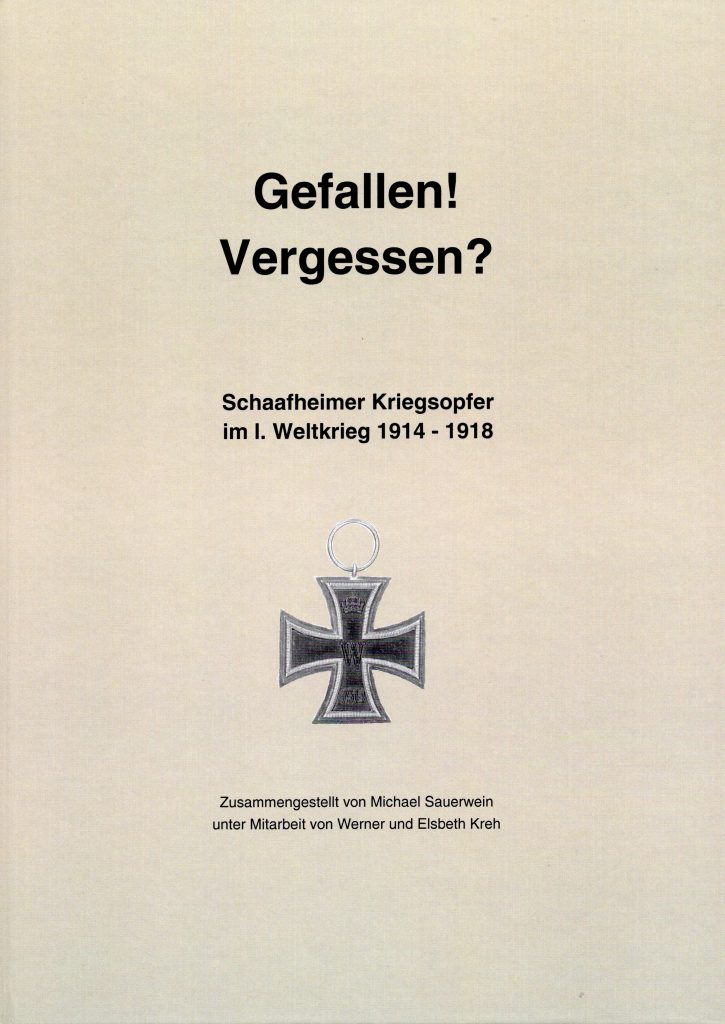
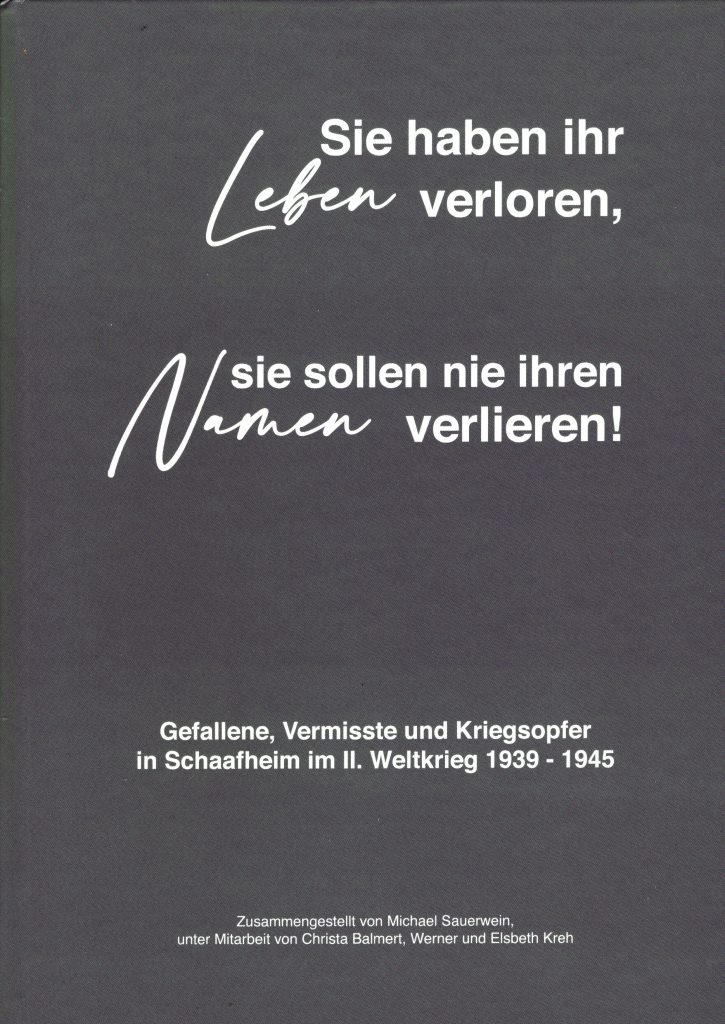
Alle Ausgaben von "Scheffemerisches" - Lokalgeschichte in Kurzfassung
Diese Hefte bieten kurze Einblicke in die scheffemerische Geschichte und stehen kostenlos zum Download und Ausdrucken bereit. Viel Vergnügen beim Stöbern!
In den letzten zwei Jahrhunderten ist die Geschichte des „Löwen“ eng mit der Geschichte der Familie Arnold verbunden. Fast ein Dutzendmal erscheint im Stammbaum der Schaafheimer Arnolde der Vorname Nicolaus, meistens verbunden mit Johann. (Johann und Nicolaus zusammen ergab dann „Hannickel“.) Viermal war ein Johann Nicolaus Arnold Gastwirt und Bürgermeister.
Anfang der 80-er Jahre am Stammtisch der „alten Herrchen“ erzählt.
Zu den bedeutendsten historischen Siedlungen des Kreises gehört Schaafheim, das durch seinen geschlossenen historischen Kern eine herausragende Gesamtanlage bildet.“ So beurteilen Fachleute unseren Ort im Hinblick auf den Denkmalschutz. Machen Sie mal einen Spaziergang durch den alten Ortskern und schauen Sie sich einmal die denkmalgeschützten Gebäude an. Der „Tag des offenen Denkmals“ am 12. September 1999 ist sicher eine schöner Anlass dazu. Die Kirche und die Kapelle sowie die „Heimatstube Batsch-Sentiwan“ im alten Backhaus sind an diesem Tag zur Besichtigung geöffnet. Die Beschreibungen in diesem Heft und der Übersichtsplan sollen Ihnen ein hilfreicher Wegweiser sein.
Vom Vorgängerbau der heutigen evangelischen Kirche in Schaafheim gibt es bis auf eine im Jahr 1840 aus dem Gedächtnis erstellte Skizze keine Darstellung. Jetzt ist es nach jahrelangen Forschungsarbeiten gelungen, das Aussehen dieser Kirche so darzustellen, daß sich jeder ein Bild davon machen kann.
Scheffemerisches 4: Alte Schaafheimer Kirche „wiedererstanden“
In einer Urkunde überträgt Karl IV., römischer Kaiser (1347-1378), am 6. Februar 1368 zu Frankfurt am Main dem Edlen Ulrich von Hanau, „des Reiches Landvogt in der Wetterau“, für seine Dörfer Marköbel, Bruchköbel, Dorffelden und Schaafheim alle Freiheiten, die er zu Hanau und Windecken hat. Am 20. August 1401 wurden in Weißenburg und am 17.Oktober 1404 in Heidelberg von König Ruprecht von der Pfalz – er hatte das Oberlehen über Schaafheim – die „Freiungen“ seiner Städte wie in Frankfurt oder Gelnhausen gewährt oder richtig gesagt: bestätigt. Mit den Stadtrechten begannen die Schaafheimer mit der Planung einer Stadt, die für die damalige Zeit sehr großzügig angelegt wurde.
In einem Vortrag in Schaafheim über „Weit verbreitete Rechtsirrtümer“ erläuterte Rechtsanwalt und Notar Uwe Friedrich eine Ehevertragsform, die er den „Schaafheimer Güterstand“ nennt. Der Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins bat ihn, dieses zu dokumentieren.
Scheffemerisches 6: Traktat über den „Schaafheimer Güterstand“
In den ältesten Urkunden, die im Archiv des Schaafheimer Rathauses aufbewahrt werden, den Strafakten aus dem Jahr 1497, also vor mehr als 500 Jahren, taucht der Name eines Bäckers viermal auf. Dreimal, weil „das broth und die weck zu klein gemacht“ waren, einmal, weil er Holz, das er zum Bauen von der Gemeinde bezogen hatte, nicht verbaut hatte. Vermutlich hat er es in seinem Backofen verheizt. Solche Delikte ziehen sich über viele Jahrhunderte durch die Strafakten in Schaafheim wie ein roter Faden.
Seit Jahrtausenden wurde von den Urvölkern Europas das Vieh zur Weide getrieben – Nomaden gibt es heute noch in den Steppen im Norden Skandinaviens und in den Weiten Russlands. Wie mit einem Schlag war diese Epoche in Mitteleuropa beendet. Rund 100 Jahre nach dem Dreißigjährigen Krieg, Mitte bis Ende des 18. Jahrhunderts, veränderte sich die Landwirtschaft und auch das Aussehen der Schaafheimer Feldflur. Was war passiert?
Die Mühlgasse in Schaafheim – heute erinnert nur noch der Name an die vielen Jahrhunderte, als dort eine Wassermühle mehr schlecht als recht ihre Arbeit verrichtete. Nicht einmal der Bach, der sie einstmals antrieb, ist mehr zu sehen. Selbst der Straßenname ist neueren Datums, denn in einem Plan von 1849, zwei Jahre bevor die Mühle endgültig stillgelegt wurde, heißt die heutige Mühlgasse noch Grabengasse.
Der Heimat- und Geschichtsverein erinnert mit neuen Schildern an drei Persönlichkeiten und ihre Geschichte mit Schaafheim.
Dies ist das zentrale Thema des „Tag des offenen Denkmals“ im Jahr 2005, der inzwischen nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa begangen wird. In fast allen Städten und Gemeinden Deutschlands gibt es Denkmäler, Gedenktafeln und Mahnmale, die an die Opfer der Kriege erinnern. Gleichzeitig sollen sie zum Frieden ermahnen. So auch in Schaafheim.
Ein Vortrag von Dr. Ulrich Eisenbach, Hessisches Wirtschaftsarchiv, Darmstadt.
Scheffemerisches 12: Die Molkerei Schaafheim und ihre Genossenschaft
Vor 50 Jahren lief die Kerb in Schaafheim anders als heute ab: Ausrichter waren nicht die großen Vereine, sondern die Schaafheimer Gastwirte im Wechsel; die Kerbburschen rekrutierten sich aus dem Jahrgang der Zwanzigjährigen; es war üblich, dass die Veranstalter von den Kerbbesuchern Eintritt kassierten; mit den ausrichtenden Wirten handelten die Kerbburschen vorher die „Bedingungen“ für sich selbst aus: freier Eintritt, die Menge Freibier etc..
Dies ist die Geschichte einer langen Auseinandersetzung, die in den Jahren 1902 bis 1908, also vor rund 100 Jahren, zwischen der Kirchengemeinde und der bürgerlichen Gemeinde in Schaafheim ausgetragen wurde.
Scheffemerisches 14: Sechs Jahre Streit ums Kirchengrundstück
In Schaafheim gibt es vier Arten von Denkmälern für Soldaten, die in drei Kriegen gekämpft haben.
ie haben ja ein Kleinod hier“, das waren die ersten Worte von Dr. HansJoachim Haaßengier vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen, als er das erste Mal vor der Alten Kapelle, stand. Eigentlich war er aus einem anderen Grund im Jahr 2003 nach Schaafheim gekommen, der Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins verband damit aber auch die Besichtigung der Alten Kapelle, die sich damals in einem beklagenswerten Zustand befand. „Da machen wir was“, waren Dr. Haaßengiers Worte nach einer ausführlichen Erörterung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen.
Scheffemerisches 16: Die Alte Kapelle – ein 500 Jahre altes Kleinod
In den Jahren 1946 bis 1948 betrieb Rolf Giuriolo, damals wohnhaft in Schaafheim in der Babenhäuser Str. 19, „im Leimert“ am unteren Ende der Schiffwegs- oder Lerchenbergshohl eine Ziegelei. Es war nicht das erste Mal, dass dort Ziegel hergestellt wurden. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts wurden dort, unterhalb der Radheimer Straße, Lehmsteine für den Hausbau hergestellt.
Fast schon vergessen ist ein landwirtschaftlicher Zweig, der in früheren Jahren auch in Schaafheim den Bauern ein erträgliches Einkommen bringen sollte: der Tabakanbau.
Määkuh“ in Aschaffenburg – „Meekuh“ weiter flussaufwärts – „Moakuh“ in Scheffemer Mundart – alteingesessene Bewohner unserer Region kennen diesen Ausdruck noch. Es handelt sich um ein technisches Monstrum, mit dem antriebslose Kähne auf dem Main geschleppt wurden: Ein Kettenschleppschiff.
Der 9. Längengrad östlich Greenwich verläuft durch Deutschland. Auf ihm liegen von Nord nach Süd gesehen die Städte Husum, Porta Westfalica, Bad Meinberg, Arolsen, Hanau, Michelstadt, Eberbach, Leonberg, Sindelfingen und Stockach. Zwischen Hanau und Michelstadt liegt Schaafheim auf dem 9. Längengrad.
Als Graf Reinhard III. von Hanau-Lichtenberg 1736 ohne männliche Erben starb, entspann sich zwischen den beiden Linien der Landgrafen von Hessen in Darmstadt und Kassel ein heftiger Streit um die Erbnachfolge in der verwaisten Grafschaft. Im Zuge dieser Auseinandersetzungen, die sich hart an der Grenze eines Krieges bewegten, besetzten 1736 hessen-darmstädtische Truppen Schaafheim, „um diesen prämittierten Teil des Amtes Babenhausen“ für das Darmstädter Haus zu sichern.
Scheffemerisches 21: Vor 270 Jahren – Soldaten in Schaafheim
S o überschrieb die „Nachtausgabe“, eine Frankfurter Tageszeitung, im Jahr 1954 eine dreiteilige Artikelserie über Georg Leilich, den Schaafheimer Heilpraktiker. Aus ganz Deutschland reisten Patienten nach Schaafheim, um bei ihm Linderung ihrer Leiden zu finden.
Im Jahr 2018 jährt sich die sog. Reichskristallnacht oder Pogromnacht zum achtzigsten Mal. 1938 wurden in der Nacht vom 9. zum 10. November überall in Deutschland von einem durch das nationalsozialistische Regime aufgestachelten Mob die Gotteshäuser der jüdischen Mitbürger geschändet und zerstört.
Scheffemerisches 23: Zwei Jahre vor der Pogromnacht 1938 – Bau einer neuen Synagoge geplant
Dass ein Weindorf, wie es Schaafheim einmal war, auch eine (oder bestimmt mehrere) Keltern gehabt haben muss, ist eigentlich selbstverständlich. Denn, wie sonst hätte man aus den Reben den begehrten Most und Wein herstellen können? Begehrt war der Rebensaft, dies lässt sich aus den Akten und Rechnungsbüchern ersehen, hat Schaafheim doch in guten Jahren über 10.000 Fuder (ca. 100.000 Liter) Wein gekeltert (1 Fuder = 6 Ohm; 1 Ohm = 160 l).
Wer will uns in Schaffheim die Kirb verbieten? Das geht nicht! Das lassen wir nicht zu. Und das ging damals, anno 1567 auch nicht. Das geht nicht, schrien alle laut den Pfarrer an, doch der setzte seine Kontrahenten in den Bann. Nun, es entwickelte sich eine dörfliche Fehde in Schaafheim, ein kleiner Machtkampf zwischen dem damaligen Pfarrer Franziscus Ithmann und dem Schultheiß Anastasius Blankh.
Was hat der Pfarrer Grundiße zu Hanau und Kinzdorf mit der Vicarei Schaafheim, dem Pfarrer Winterrauche zu tun? War doch die Marienkirche in Hanau für Schaafheim die zuständige Stiftskirche und sie verfügte über das Patronatsrecht. Aus dieser ersten, scheinbaren Unklarheit ergibt sich eine interessante Entwicklungsgeschichte.
Scheffemerisches 26: Episode des Johan Winterrauch, Pfarrer zu Schaafheim (1431 – 1452)
Stolz steht es da, das „Schäferhaus“ in der Weedstraße. Es ist das älteste Haus Schaafheims. Vor 1500, also zu Zeiten der Errichtung des Wartturms von Schultheiß Max Ithmann erbaut, diente es als Amtshaus der Hanau Lichtenbergischen Verwaltung, der Schaafheim damals unterstand. 1822 kam das Haus nach mehreren Eigentümerwechseln in den Besitz der Familie Schäfer. Es war damals das am höchsten versicherte Haus in Schaafheim. Die Schäfers waren beileibe nicht Besitzer einer Schafherde oder Schafhirten, nein, seine heutige Bedeutung hat es für Schaafheim, weil es das Geburtshaus des Johann Georg Schäfer, bekannt als der „Odenwalddichter“, am 1. November 1840 ist. Nach ihm es heute benannt.
Am 11. Oktober 2022 jährt sich der Geburtstag Professor Heinrich Geißlers zum 150. Mal. Ein Anlass, auf das Leben dieses für die Heimatforschung in Schaafheim bedeutenden Mannes zurückzublicken.
Zwei hochinteressante Urkunden sind vor einiger Zeit dem Heimatund Geschichtsverein übergeben worden. Sie wurden von der „Hochfürstl. Heßen Hanau Lichtenbergische Rent-Cammer“ in Buchsweiler ausgestellt. Es handelt sich dabei um die Verpflichtung zu bestimmten Aufgaben in der Grafschaft Hanau-Lichtenberg aus den Jahren 1771 und 1779. Die Urkunden befinden sich in Schaafheimer Privatbesitz.
Es ist ja allgemein bekannt, dass es in Schaafheim eine jüdische Gemeinde gegeben hat. Eine Mikwe ist ein rituelles Tauchbad der Juden und überall dort zu finden, wo jüdische Gemeinden waren. Das Wort „Mikwe“ (Mz. Mikwaot) heißt „Ansammlung von Wasser“. Nach dem Artikel von Wolfgang Roth gab es in Schaafheim mindestens zwei Mikwen.
Scheffemerisches 30: Die Mikwe – ein Wasserloch mit Geschichte
… weitere Veröffentlichungen folgen!